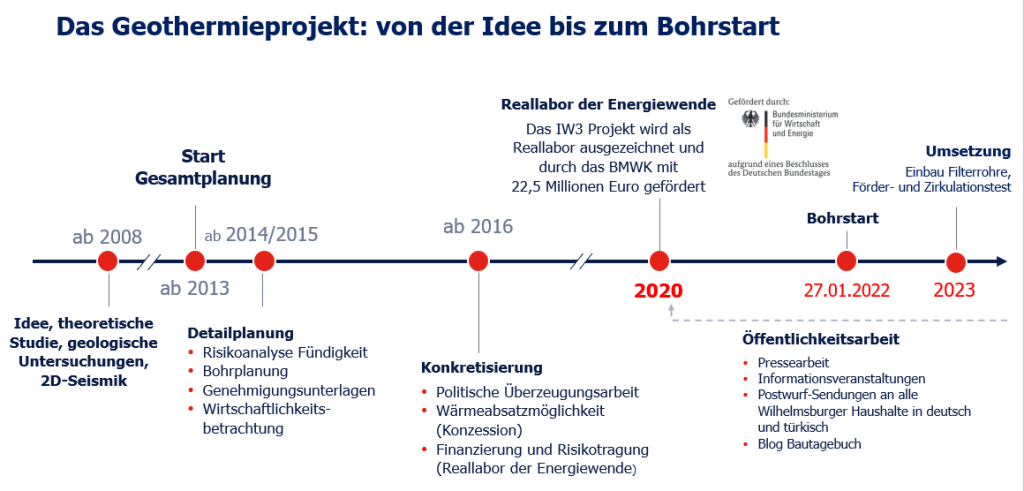Hoher Besuch auf der Geothermie-Baustelle: Umweltsenatorin Katharina Fegebank macht sich vor Ort ein Bild
Die Geothermie-Anlage schreitet in ihrer Realisierung voran: Der Bau des Heizhauses für die Wärmepumpenanlage hat begonnen. Gestern war Katharina Fegebank, Hamburgs Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, zu Besuch auf der Baustelle. „Neben Abwärme aus Industrie und thermischer Abfallbehandlung und Umweltwärme aus Luft und Wasser ist die Geothermie als erneuerbare Energie ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Wärmewende. Ich freue mich daher, dass die Hamburger Energiewerke bei der Geothermie wie auch bei Großwärmepumpen, Power-to-Heat und Industrie-Abwärme echte Pionierarbeit leisten“, sagte sie. „Wir zeigen damit ganz deutlich: Wir wagen Neues und wollen alle sinnvollen Möglichkeiten nutzen, unsere Energie- und Wärmeversorgung klimafreundlich zu gestalten.“
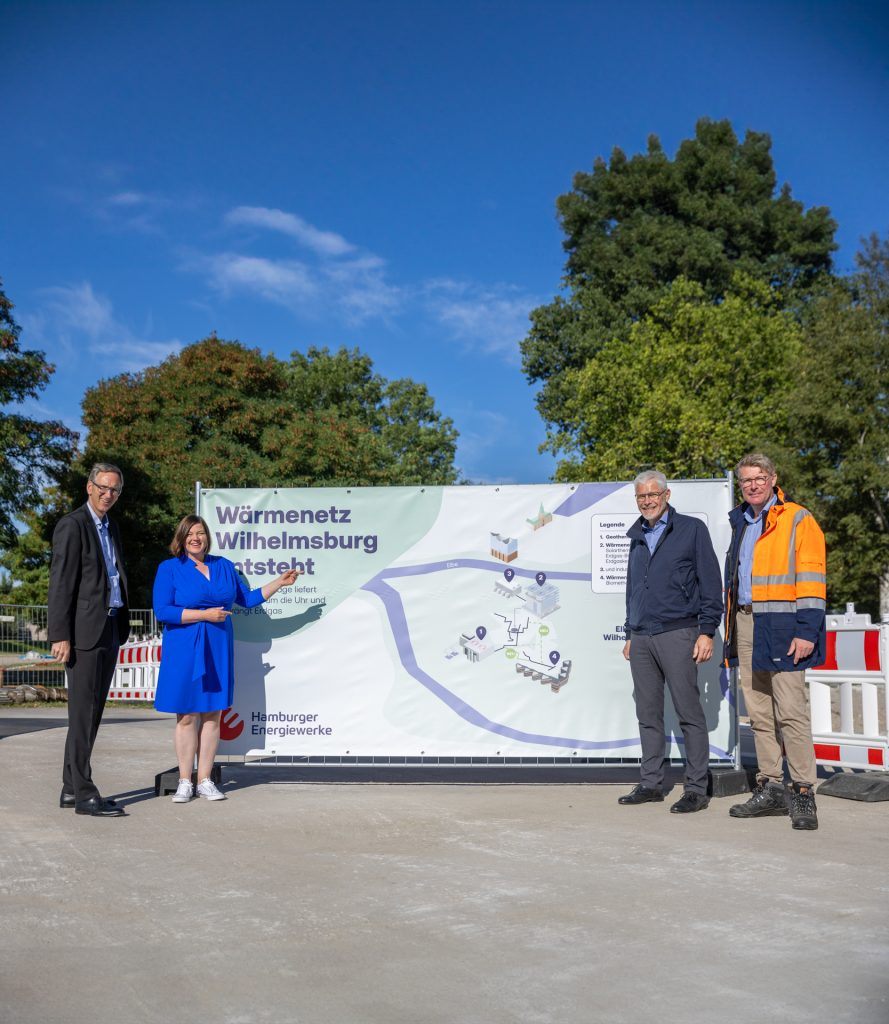
Zu Besuch bei der künftigen Geothermie-Anlage (v.l.: HEnW-Geschäftsführer Michael Prinz; Umweltsenatorin Katharina Fegebank; Thomas-Tim Sävecke, HEnW-Geschäftsbereichsleiter Engineering; Dr. Carsten Hansen, Leiter Forschung und Entwicklung des Geothermieprojekts). Bild: Hamburger Energiewerke
1.200 m2 Hightech für die Wärmewende
Das Heizhaus selbst wird auf einer Fläche von insgesamt 1.200 m2 eine Maschinenhalle und ein Betriebsgebäude umfassen. Um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten, sind bereits mehr als 140 Pfähle mit einer Länge von je 11 Metern in den Untergrund gebracht worden. Nach Herstellung des Betonfundaments soll nahtlos das Heizhaus errichtet werden. Dort steht zukünftig die mehrstufige Wärmepumpen-Anlage, die das Temperaturniveau des Thermalwassers aus der Geothermie auf das Niveau der Fernwärme in Wilhelmsburg anhebt. Auch diese ist bereits in der Fertigung.
Die Wärmepumpen-Anlage wird – je nach Anlageneinsatzplanung – über ein eigenes hocheffizientes Blockheizkraftwerk betrieben oder – Stand heute – mit Strom aus dem Versorgungsnetz. Dieser hatte bereits in 2024 einen Anteil erneuerbarer Energien von nahezu 60 Prozent, Tendenz steigend. Perspektivisch haben wir die Ambition, unsere Wärmepumpen mit Ökostrom zu betreiben. Auf dem Dach des Gebäudes wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet, die mit einer Leistung von 25 Kilowattpeak (kWp) den Strom für den Betrieb der Klimatisierung und Leittechnik erzeugen wird.

So soll das Heizhaus der Geothermie-Anlage in Hamburg-Wilhelmsburg aussehen.
Fortschritte im Leitungsbau
Um die klimafreundliche Fernwärmeversorgung auf Hamburgs größter Elbinsel weiter auszubauen, arbeiten die Hamburger Energiewerke daran, zwei bereits existierenden Wärmenetze – Energiebunker und Energieverbund – zusammenzuschließen, schrittweise zu verdichten und auszubauen. Die Leitungsbauarbeiten für das so entstehende Verbundnetz Wilhelmsburg LINK kommen ebenfalls gut voran. Die Anbindungsleitung der Geothermie-Anlage an den Energiebunker wird insgesamt 1,4 Kilometer lang. Gut 80 Prozent sind schon gebaut, so dass sie noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. Ein 35 Meter langer Tunnel zur Unterquerung des Bahndammes und der daneben liegenden Hauptverkehrsstraße, die größte Herausforderung für den Leitungsbau, wurde bereits erfolgreich in diesem Februar gebaut. Auch die ersten 200 Meter der rund ein Kilometer langen Leitung zur Verbindung der beiden Wärmenetze – Energiebunker und Energieverbund sind bereits im Bau.
Michael Prinz, Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, führte aus: „Wie geplant werden wir die drei neuen IBA-Quartiere Rathausviertel, Elbinselquartier und Spreehafenviertel sukzessive anschließen. Darüber hinaus sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen mit Wohnungsbaugesellschaften über den Anschluss mehrgeschossiger Gebäude im Bestand.“
Hier geht’s zum NDR Beitrag
Der NDR und weitere Medien begleiten den Baustellenbesuch der Senatorin. Hier gibt es den Fernsehbeitrag.